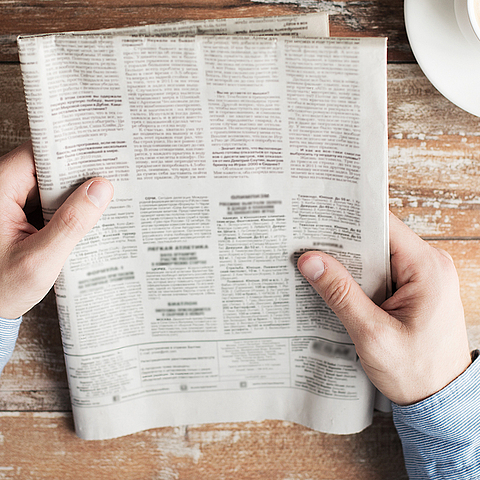DHBW Mosbach Studierende mit A|U|F Nachhaltigkeitspreis für innovative Fassadenkonzepte ausgezeichnet
Lehrkonzept für nachhaltiges Bauen und Aluminium-Recycling erhält Anerkennung vom Branchenverband
Von lösbaren Verbindungen bis zu luftreinigenden Textilien: Studierende der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach beweisen mit preisgekrönten Konzepten, dass nachhaltige Fassaden nicht nur umweltfreundlich, sondern auch wirtschaftlich attraktiv sein können. Die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung des A|U|F e.V. würdigt kreative Ansätze, die die Zukunft des nachhaltigen Bauens neu definieren könnten.
Der Nachhaltigkeitspreis für Fassadentechnik wurde vom A|U|F e.V. (Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau) ins Leben gerufen, um die Kompetenzen angehender Bauingenieure bei der Planung nachhaltiger Fassadenprojekte zu fördern. Mit einer jährlichen Dotierung von 5.000 Euro unterstreicht der Verband sein Engagement für die Ausbildung zukünftiger Fachkräfte.
„Die Sensibilisierung junger Bauingenieure für Umwelt- und Klimathemen ist zentrales Element unseres dualen Studiums“, erklärt Prof. Dr.-Ing. Isabelle Simons, Studiendekanin Bauingenieurwesen und Leiterin für den Studiengang Bauingenieurwesen – Fassadentechnik. „Mit diesem Preis können wir das Thema noch umfassender behandeln und Exkursionen durchführen, die Recycling und Kreislaufwirtschaft erlebbar machen.“
Seit fast drei Jahrzehnten engagiert sich die Recycling-Initiative A|U|F e.V. für einen geschlossenen Wertstoffkreislauf für Aluminium aus Bauanwendungen. Für Vorstandsmitglied Walter Lonsinger, der die Preise überreichte, ist die gute Ausbildung und Information der Menschen ein vorrangiges Anliegen: „Die jungen Fassadenspezialisten werden neue Wege finden, um Bau- und Sanierungsaufgaben zu lösen. Aluminium ist ein nachhaltiger Werkstoff, der einen festen Platz in der Zukunft der Bauwirtschaft hat.“
Praxisnahe Projektarbeit als Schlüssel zum Erfolg
Im Rahmen der Lehrveranstaltung „Konstruktive Projektarbeit I und II“ bearbeiten die Studierenden im 5. und 6. Semester reale Bauvorhaben analog zur Praxis in Metallbauunternehmen – von der Angebotsphase über die technische Konstruktionsentwicklung bis zur Arbeitsvorbereitung und Montageplanung. „Zusammen mit unseren Lehrbeauftragten versuchen wir stets, uns an realen Projekten zu orientieren“, betont Simons. Für die Projektarbeit wurden Gruppen gebildet, wobei ein Projektleiter sich vorrangig um Nachhaltigkeitsaspekte kümmert.
„Nachhaltigkeit durch Design“ gewinnt Hauptpreis
Nachhaltigkeit durch Design war das Thema der Siegergruppe. Das sechsköpfige Team erhielt Urkunden und ein Preisgeld von je 300 Euro pro Person für ihre herausragende Arbeit zum Einfluss der Konstruktion auf die Nachhaltigkeit. Ihre Präsentation beeindruckte mit einem tiefgehenden Einblick in nachhaltiges Konstruktionsdesign. Die Studierenden untersuchten drei Hauptaspekte: die Langlebigkeit von Fassadenkonstruktionen, Design for Recycling und lösbare Verbindungen.
Lösbare Verbindungen sind Konstruktionsmethoden im Bauwesen, die es ermöglichen, Bauteile später wieder zerstörungsfrei voneinander zu trennen. Im Gegensatz zu dauerhaften Verbindungen wie Verschweißen, Verkleben oder dem Einsatz von nicht lösbaren Dichtmassen werden dabei Techniken wie Verschraubungen, Steckverbindungen, Klemmprofile oder demontierbare Befestigungssysteme verwendet. Aluminiumprofile, Gläser und andere Komponenten werden am Ende des Lebenszyklus einfach getrennt und dem Recyclingkreislauf zugeführt. Dies steht im Einklang mit dem Prinzip „Design for Disassembly“ (Konstruktion für die Demontage), einem wichtigen Konzept der modernen Kreislaufwirtschaft.
„Design for Recycling“ ist ein noch umfassenderes Konstruktionskonzept, das über lösbare Verbindungen hinausgeht und die gesamte Entwicklung einer Konstruktion unter dem Aspekt optimaler Recyclingfähigkeit betrachtet. Im Fassadenbau umfasst dieser Ansatz die Materialauswahl (Verwendung von recycelbaren und idealerweise bereits recycelten Materialien, Vermeidung von Verbundwerkstoffen), die Vermeidung von Schadstoffen, die Kennzeichnung von Materialien und Dokumentation der gesamten Fassade sowie den Einsatz von standardisierten Bauteilen, die wiederverwendet werden können. In der Fassadentechnik ist Design for Recycling besonders relevant für Aluminium, da dessen Recycling bis zu 95 Prozent der Energie spart, die für die Primärproduktion benötigt wird. Als besonders innovative Beispiele stellte die Gruppe Holz-Aluminium-Konstruktionen vor und analysierten deren Vor- und Nachteile im Vergleich zu konventionellen Lösungen. Die Studierenden der DHBW Mosbach haben in ihrem Projekt gezeigt, wie durch gezielte Konstruktionsentscheidungen der spätere Rückbau, die Trennung und das hochwertige Recycling von Fassadenelementen ermöglicht werden kann.
Ein Höhepunkt der Präsentation war die Analyse des aktiv Stadthauses in Frankfurt als praktisches Beispiel für nachhaltiges Design. Anhand des Bosch-Projekts demonstrierten die Studierenden, wie lösbare Verbindungen die spätere Demontage und das Recycling von Fassadenelementen erleichtern können. Der Ausschuss lobte besonders den zukunftsorientierten Ausblick der Gruppe, der innovative Konzepte wie Doppelfassaden, begrünte Fassaden, adaptive Fassadentechnologien und die Integration von Photovoltaik in Fassadensysteme umfasste.
„Bauen für die Zukunft“ - innovative Materialien für Fassaden
Die zweitplatzierte Gruppe wurde für ihr Projekt „Bauen für die Zukunft“ mit einem Preisgeld von 200 Euro pro Person belohnt. Sie erweiterten das vorgegebene Thema um innovative Materialansätze. Die Gruppe stellte unter anderem das Produkt Alucore vor, das durch sein geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Tragfähigkeit überzeugt. Besonders hervorgehoben wurden auch luftreinigende Textilien, die in Fassaden integriert werden können und aktiv zur Verbesserung der Luftqualität in städtischen Umgebungen beitragen.
Einen innovativen Ansatz zeigte die Gruppe mit der Verwendung von schnellwachsenden Hölzern wie Bambus für Fassadenkonstruktionen. Dieser nachwachsende Rohstoff könnte konventionelle Materialien ersetzen und so zur Ressourcenschonung beitragen. Auch die Nutzung von Schadholz, das durch Borkenkäferbefall oder andere Schäden für die normale Holzverarbeitung ungeeignet ist, wurde als nachhaltige Alternative präsentiert.
Stärkung der Hochschulausbildung durch Industriekooperation
In der Praxis werden bei der Projektierung von Sanierungsaufgaben immer häufiger schlüssige Nachhaltigkeitskonzepte vorausgesetzt. Die Studierenden der DHBW Mosbach werden durch die Teilnahme am Wettbewerb optimal auf diese Anforderungen vorbereitet. Sie erhalten die Gelegenheit, sich intensiv mit Nachhaltigkeit, Rohstoffsicherheit und dem geschlossenen Wertstoffkreislauf im Bereich Fenster, Türen und Fassaden auseinanderzusetzen.
„Diese Kooperation macht es möglich, Recycling und Kreislaufwirtschaft erlebbar zu machen“, betont Studiendekanin Simons. Besuche auf den Projektbaustellen, bei Schrottverwertern und in Aluminiumrecycling-Werken sind nur ein Baustein. Erst wenn man ein Projekt selber planen muss – hier noch im sicheren Lehrumfeld – muss man die konstruktiven Möglichkeiten einer nachhaltigen Planung intensiv betrachten und diskutieren.“