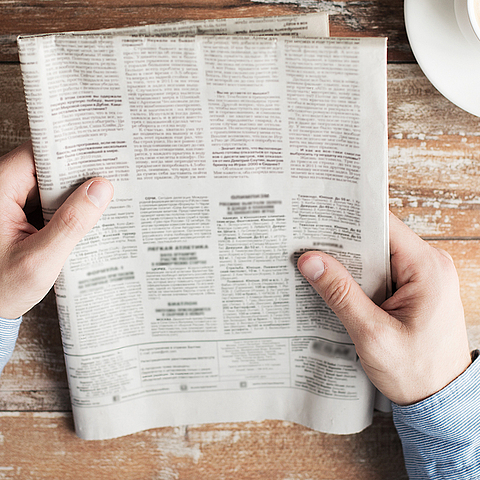Die DHBW Mosbach wird 30 und wagt einen Blick in die Zukunft
30 Jahre ist es her, dass die DHBW Mosbach, damals noch Berufsakademie Mosbach, mit dem Studiengang Industrie und 18 Studierenden in Mosbach den Grundstein für den heutigen Erfolg gelegt hat. Grund zum Feiern hatte auch die Stiftung „Pro DHBW Mosbach“, die seit 10 Jahren die DHBW Mosbach unterstützt. „Es ist viel besser gekommen, als wir uns erträumt hätten“, so der Rektor der DHBW Mosbach, Prof. Reinhold R. Geilsdörfer. Das Jubiläum wolle er zum Anlass nehmen, nicht, wie sonst üblich, zurück zu schauen, sondern „den Blick nach vorne zu wagen“, so Prof. Geilsdörfer. Zeitgleich zum Jubiläum veröffentlichte die DHBW Mosbach eine Kurzstudie zum Thema „Die Zukunft der Bildung – Vier Thesen, wie wir künftig lehren, lernen und arbeiten“, die sich mit den künftigen Anforderungen an Bildungsinstitutionen und Unternehmen auseinandersetzt.
Ministerialdirektor Klaus Tappeser ist überzeugt vom Dualen System: „Die DHBW ist der Kristallisationskern von gut ausgebildeten jungen Menschen und von Unternehmen, die das zu schätzen wissen.“ Besonders lobt der Amtschef im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst den Einsatz von Rektor Prof. Geilsdörfer bei der Entwicklung der DHBW Mosbach bis heute. „Das unermüdliche Engagement von Prof. Reinhold Geilsdörfer hat maßgeblich zum Erfolg der DHBW beigetragen. Er verkörpert das duale System und ist als herausragender Netzwerker eng mit der Wirtschaft und der Region verbunden.“ Das zentrale Thema in Baden-Württemberg, so Tappeser, sei die Zukunft der Bildung, wie auch das Motto des Abends. Damit Märkte wachsen könnten, seien in erster Linie fachlich hervorragend ausgebildete Mitarbeiter nötig.
Matthias Horx, Gründer und Inhaber des Zukunftsinstituts, betonte in seiner Präsentation: „Die Finanzkrise hat uns einen ganzen Schritt weitergebracht, der Prozess führt zu einer neuen Weltordnung. Wir befinden uns gerade in einer Komplexitätsentwicklung nach oben.“ Wohin genau, dafür fehle noch der richtige Begriff, so Horx weiter. Ob „postindustrielle Ökonomie, Wissensgesellschaft oder Informationsgesellschaft“, fest stehe bereits, welche Anforderungen an diese neue Arbeitswelt bestünden: „Das Fließband im 21. Jahrhundert braucht Kooperation, Individualität und Diversität“ ist sich Horx sicher. Den größten Anteil der Wertschöpfung würden künftig komplexe Kommunikation und analytische Arbeit ausmachen, während sich reproduzierbare Tätigkeiten mehr und mehr automatisieren ließen. Ziel müsse eine Gesellschaft sein, die auf Können und Talent aufbaut, denn: „Jeder Mensch hat ein Talent, mit dem er in einem bestimmten Bereich Meister werden kann“. Viel zu häufig würden Politik und Medien sich im Bildungsbereich auf Nicht-Talent in ihren Diskussionen konzentrieren. Wichtiger sei es stattdessen, dass Schulen deshalb über ganz neue Hauptfächer wie Kreativität, Teamfähigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstkompetenz und emotionale Intelligenz nachdenken.
Inwiefern die gesellschaftlichen Veränderungen und die neuen Arbeitswelten auch zu veränderten Herausforderungen für Hochschulen führen, skizzierte Rektor Prof. Reinhold R. Geilsdörfer als Einstieg in die Podiumsdiskussion. Dabei stützte er sich auf die Ergebnisse der Kurzstudie „Die Zukunft der Bildung“, in welcher vier Thesen aufgestellt werden, wie wir künftig lernen, lehren und arbeiten. Er betonte, dass Hochschulen und die Lehrenden künftig verstärkt die Rolle des Wissensmanagers einnehmen müssten, der „die Schneisen durchs Dickicht des verfügbaren Wissens schlägt“. Auch wies er darauf hin, dass trotz aller Digitalisierung und Virtualisierung von Wissen und Bildung dennoch die Lehre vor Ort wichtig bleibt, das „Erlebnis vor Ort“.
Bei der anschließenden Podiumsdiskussion fühlte der ZEIT-Journalist und Bildungsexperte Jan-Martin Wiarda den sechs Diskussionsteilnehmern aus Politik, Unternehmen, Zukunftsforschung und der DHBW auf den Zahn bezüglich deren Vorstellungen, wie die Zukunft der Bildung denn nun konkret aussehen könnte. Prof. Dr. Jürgen Kletti, Geschäftsführer der MPDV Mikrolab GmbH und Dr.-Ing. E.h. Manfred Wittenstein, Unternehmer und ehemaliger VDMA-Präsident, waren sich darüber einig, dass es nicht nur um theoretisches Wissen, sondern insbesondere um die Anwendung in der Praxis gehe. Gerade auf das Umsetzungswissen komme es an, so Dr. Wittenstein. Gründungspräsident der DHBW, Prof. Dr. Hans Wolff, empfindet die Bildungssituation in Deutschland als gar nicht so prekär, wie häufig kritisiert. „Wir haben hohe Bildungsstandards im Bereich Master und Promotion. Wir brauchen uns deshalb nicht vor den skandinavischen Ländern verstecken.“ Der Zukunftsforscher Matthias Horx kritisierte, dass der Hochbildungsbegriff hoffnungslos akademisiert sei. Er ist davon überzeugt, dass Menschen in erster Linie Charakterbildung und Metafähigkeiten benötigten, die die Menschen später zur Arbeit befähigten. Ministerialdirektor Klaus Tappeser wünschte sich, dass die Menschen im Bildungssystem individuell abgeholt werden. „Wir brauchen längere gemeinsame Lernzeiten, die frühkindliche Phase muss genutzt werden, um Kinder früh zu fördern und zu fordern.“
Im Schlusswort betonte Prof. Dr. Jürgen Kletti in seiner Funktion als Vorsitzender des Hochschulrates, wie gut das duale Studienmodell der DHBW Mosbach funktioniere. „Das Modell Duale Hochschule hat sich etabliert. Knapp 90% der Absolventen haben nach Studienabschluss einen Arbeitsplatz oder nehmen ein weiterführendes Studium auf“. Wichtig sei es jedoch immer, sich vor Augen zu halten, mit welcher Zielsetzung man lerne und sich weiterbilde.